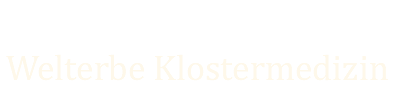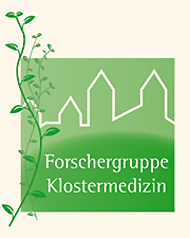Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
Mit Knoblauch gewürztes Lamm ist eine Spezialität des Frühjahrs. Aber nicht jeder mag ihn, dabei zeigt er gerade für den modernen Menschen wichtige Eigenschaften vor allem im Bereich der Prävention; schließlich sind Herz-/Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck und Arterienverkalkung die häufigste Todesursache in den Industrieländern.
Schon in der ersten deutschen Naturkunde des in Wien und Regensburg wirkenden Konrad von Megenberg aus dem Jahr 1348 heißt es: Der Knoblauch ist der Theriak der Bauern. Der Theriak - eine komplexe, teure Arzneimischung - galt seit der Antike als das wirkungsvollste Heilmittel.
 Der Knoblauch ist unter den Lauchgewächsen (Unterfamilie Allioideae der Amaryllidaceae) die wirkungsvollste Heilpflanze. Größter Produzent ist China, weitere große Anbauländer sind Indien, Thailand, Ägypten, Südkorea, Spanien und die Türkei.
Der Knoblauch ist unter den Lauchgewächsen (Unterfamilie Allioideae der Amaryllidaceae) die wirkungsvollste Heilpflanze. Größter Produzent ist China, weitere große Anbauländer sind Indien, Thailand, Ägypten, Südkorea, Spanien und die Türkei.
Der in der Heilkunde ausschließlich verwendete Pflanzenteil ist die Knoblauch-Zehe. Ihre Hauptwirkstoffe sind organische Schwefelverbindungen wie das Alliin, weitere Bestandteile sind u.a. Saponine und Selen. Besonders wichtig ist das ursprünglich in der Pflanze geruchlose Alliin. Beim Zerkleinern der Zehen entsteht jedoch Allicin, das für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich ist. Werden die Zehen zusammen mit Öl leicht erwärmt, bildet sich aus dem Allicin wiederum Ajoen. Die Alliinase ist hitzeempfindlich; starkes Erhitzen vermindert die Allicinbildung.<\/p>
Die Inhaltsstoffe zeigen in vitro antibakterielle und antimykotische Effekte; die klinische Relevanz ist begrenzt. Knoblauch kann die Thrombozytenaggregation beeinflussen; zusammen mit Thrombozytenhemmern/Antikoagulanzien vorsichtig anwenden und vor Operationen in der Regel 1–2 Wochen absetzen. Zu Blutfetten und Blutdruck sind in Studien kleine, inkonsistente Effekte beschrieben; Knoblauch ist eine mögliche Begleitmaßnahme, ersetzt aber keine ärztliche Therapie.
Knoblauch kann deshalb – als Teil eines Lebensstilkonzepts – zur Begleitung bei leicht erhöhten Blutfettwerten eingesetzt werden. Die häufig genannte Tagesmenge liegt bei etwa 4 g (ca. 2–3 Zehen). Für die Bildung von Allicin sollten die Zehen nach dem Zerkleinern kurz stehen gelassen und nur moderat erwärmt werden; starkes Erhitzen vermindert die Allicinbildung. Geruchsreduzierte, standardisierte Präparate können eine reproduzierbare Dosierung ermöglichen.
Literatur: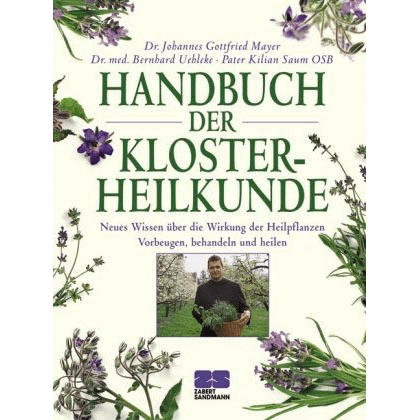 Johannes G. Mayer, Bernhard Uehleke, Pater Kilian Saum: „Handbuch der Klosterheilkunde“, ZS-Verlag München.
Johannes G. Mayer, Bernhard Uehleke, Pater Kilian Saum: „Handbuch der Klosterheilkunde“, ZS-Verlag München.
Letzte Änderungen
- Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
- Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
- Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
- Hildegard von Bingen, Mondfinsternis und das Eruptionscluster 1108–1110
- Presseschau zur Schafgarbe (Arzneipflanze des Jahres 2025)
- Arzneikürbis - Cucurbita pepo L., Cucurbitaceae
- Publikationen zu Autoren & Werken
- Publikationen zur Klostermedizin
- Publikationen zu Pflanzen
- Aktuelles und Termine
- Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
- Andorn - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
- Angelika - Angelica archangelica L., Apiaceae
- Apfelbeere - Aronia MEDIK., Rosaceae
- Sesam - Sesamum indicum L., Pedaliaceae
- Rosen - Rosa-Arten: Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa canina L.
- Weißdorn - Crataegus monogyna JACQ.; Crataegus laevigata (POIR.) DC.; Crataegus nigra WALDST. & KIT.
- Mariendistel - Silybum marianum (L.) GAERTNER, Asteraceae
- Lorbeer - Laurus nobilis L., Lauraceae
- Rizinus - Ricinus communis L., Euphorbiaceae
- Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
- Ginkgo - Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae
- Eukalyptusbaum - Eucalyptus globulus LABILL., Myrtaceae
- Schöllkraut - Chelidonium majus L., Papaveraceae
- Myrte – Myrtus communis, Myrtaceae
- Gewürzsumach - Rhus aromatica AIT., Anacardiaceae
- Borretsch - Borago officinalis L., Boraginaceae
- Keuschlamm oder Mönchspfeffer - Vitex agnus-castus L., Lamiaceae
- Schafgarbe - Achillea millefolium L., Asteraceae
- Beinwell - Symphytum officinale L., Boraginaceae
- Huflattich - Tussilago farfara L., Asteraceae
- Sägepalme - Serenoa repens (BARTR.) SMALL, Arecaceae
- Johanniskraut - Hypericum perforatum L., Hypericaceae
- Presseschau zur Blutwurz (Arzneipflanze des Jahres 2024)
- Pfefferminze - Mentha x piperita L., Lamiaceae
- Alant - Inula helenium L., Asteraceae
- Acker-Schachtelhalm oder Zinnkraut - Equisetum arvense L.
- Aus dem Alltag eines Medizinhistorikers
- Hat Hildegard von Bingen kolloidales Silber empfohlen?
- Woher bekommt man verlässliche Informationen zur Pflanzenheilkunde?
- Literatur
- Arzneipflanze des Jahres 2025: Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium
- Arzneipflanze des Jahres 2024: Blutwurz - Potentilla erecta
- Die Mitglieder
- “Drink before breakfast and vomit”: Zur Geschichte von Hamamelis in Amerika und Europa
- Arzneipflanze des Jahres 2023: Echter Salbei - Salvia officinalis
- Presseschau zum Echten Salbei (Arzneipflanze des Jahres 2023)
- Neues Supermittel: Weg mit Kokos, her mit Ginseng!
- Supermondfinsternis
- Presseschau zum Mönchspfeffer (Arzneipflanze des Jahres 2022)
- Arzneipflanze des Jahres 2022: Mönchspfeffer, Keuschlamm - Vitex agnus-castus
- Fasten (21): Fasten bei Hildegard von Bingen
- Goethe und das Coffein
- Presseschau zum Myrrhenbaum (Arzneipflanze des Jahres 2021)
- Impressum
- Arzneipflanze des Jahres 2021: Myrrhenbaum - Commiphora myrrha
- Deutsches Arzneibuch 6 und Ergänzungsbuch 6
- Kann man sich gegen Infektionen schützen?
- Kontakt
- Fortbildung
- Neuer Ausbildungskurs Klostermedizin und Phytotherapie
- Presseschau zum Lavendel (Arzneipflanze des Jahres 2020)
- Arzneipflanze des Jahres 2020: Echter Lavendel - Lavandula angustifolia
- Weihnachtsgewürze
- Fasten (31): Die Wurzeln des modernen Heilfastens
- Zum 838. Todestag von Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Weißdorn (Arzneipflanze des Jahres 2019)
- Immenblatt - Weiße Taubnessel - Zitronenmelisse: Eine Verwechslungsgeschichte über Jahrtausende
- Wir hatten uns doch noch so viel vorgenommen...
- Senföle bekämpfen bakterielle Erreger auf mehreren Ebenen
- Förderung der pankreatischen Restfunktion bei EPI-Patienten durch Rizoenzyme aus Reispilzen
- Feinstaub ohne Feinsinn?
- Zur Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt
- Von tatsächlichen und angeblichen Krebsmitteln aus der Natur
- Erkältungskrankheiten umfassend therapieren: Über den Einsatz von Senfölen und Bitterstoffen
- Buchtipp: Pflanzliche Arzneimittel - was wirklich hilft
- A View to a Kill? Im Angesicht des Todes?
- Mikronährstoffe zwischen Nutzen und Risiko
- Ätherische Öle bei Lyme-Borreliose: Laborstudie deutet auf gute Wirksamkeit verschiedener pflanzlicher Öle hin
- Vorträge in Kooperation mit dem Bund Naturschutz
- Arzneipflanze des Jahres 2019: Weißdorn - Crataegus
- Zum Begriff Naturheilkunde, gängigen Strömungen und zur Abgrenzung des Begriffes
- Die Forschergruppe im ZDF ("Terra X: Drogen – Eine Weltgeschichte")
- Neue internationale Meta-Analyse bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger
- Überlebenschancen nach "alternativer" Krebsbehandlung
- Naturheilkunde in der Krebstherapie
- Themenheft Klostermedizin der "Deutschen Heilpraktiker-Zeitschrift"
- Novartis stoppt Antibiotika-Entwicklung: Pflanzliche Alternativen jetzt noch wichtiger
- Antibakterielle Wirkung von ätherischen Ölen verschiedener Lippenblütler
- Fasten: Ein wiederentdeckter Weg zu Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht
- Zum 100. Geburtstag von Heinrich Schipperges
- Alle Jahre wieder: Bärlauchzeit
- Zur Geschichte von Bärlauch als Heilpflanze
- Intestinale spasmolytische Wirkung von Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle bestätigt
- Pflanzliche Senföle und Andornkraut: Erkältungskrankheiten pflanzlich therapieren – Antibiotikaresistenzen vermeiden
- Wirkungsvolle Aloe
- Myrrhe bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) vielfältig einsetzbar
- Königsfarn bei Kopf-Hals-Karzinomen
- Zur Evidenz von Traubensilberkerze bei Wechseljahresbeschwerden
- Cannabis: CBD-Produkte aus dem Internet sind oft falsch deklariert